Altbau renovieren: Was zuerst angehen? Tipps, Prioritäten & Kosten

Renovierungsprioritäten-Rechner
Zuerst: Gebäudezustand prüfen
Geben Sie an, wie derzeit der Zustand Ihrer Altbauteile ist. Die Ergebnisse helfen Ihnen, die richtige Reihenfolge für die Sanierung festzulegen.
Zweiter Schritt: Prioritäten festlegen
Wählen Sie, was für Sie am wichtigsten ist bei der Sanierung.
Ihre individuelle Sanierungspriorität
Warum diese Reihenfolge?
Wenn Sie einen Altbau renovieren wollen, stehen Sie sofort vor der Frage: Was mache ich zuerst? Bei alten Gebäuden kann das Vorgehen schnell zu einem Labyrinth aus Handwerkerangeboten, versteckten Mängeln und steigenden Kosten führen. Der Schlüssel ist, die Arbeiten nach Dringlichkeit und Nutzen zu sortieren - so vermeiden Sie böse Überraschungen und halten das Budget im Griff.
Analyse des Ist‑Zustands
Bevor Sie den Hammer schwingen, führen Sie eine gründliche Bestandsaufnahme durch. Dabei sollten Sie sämtliche Bauteile und Systeme prüfen. Ein strukturiertes Bestandscheck ermöglicht, Schwachstellen früh zu erkennen spart später Zeit und Geld.
- Visuelle Inspektion von Dach, Fassade und Fundament.
- Feuchtigkeitsmessung in Wänden und Böden.
- Überprüfung von Elektrik und Heizung durch Fachleute.
- Dokumentation aller Befunde mit Fotos und Notizen.
Erst wenn Sie ein vollständiges Bild haben, können Sie die Prioritäten klar setzen.
Prioritäten setzen - Was zuerst?
Die Reihenfolge richtet sich nach drei Kriterien: Schutz des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden und Kosten‑Effizienz. Die nachfolgende Tabelle fasst die wichtigsten Bauteile zusammen und ordnet sie nach Dringlichkeit.
| Bauteil | Dringlichkeit | Kostenfaktor | Nutzen |
|---|---|---|---|
| Dach schützt das Haus vor Regen und Schnee | Hoch | 30% | Verhindert Wasserschäden, erhöht Energieeffizienz |
| Fassade außenliegende Wandoberfläche | Hoch | 25% | Schutz vor Witterung, ästhetischer Auftritt |
| Fenster ermöglichen Licht und Luft | Mittel | 15% | Verbesserte Dämmung, reduziert Zugluft |
| Heizung versorgt das Haus mit Wärme | Mittel | 12% | Komfort, Senkung der Energiekosten |
| Elektrik Stromversorgung und Leitungen | Hoch | 10% | Sicherheit, moderne Nutzung |
| Sanitär Wasserinstallationen für Bad und Küche | Mittel | 8% | Funktionalität, Hygiene |
| Innenausbau Trockenbau, Fußböden, Decken | Niedrig | 5% | Wohnkomfort, Ästhetik |
Die obersten Zeilen - Dach, Fassade und Elektrik - sollten zuerst angegangen werden, weil hier das Risiko von Folgeschäden am größten ist.
Dach und Dachisolierung
Ein undichtes Dach schützt das Gebäude vor Regen und Schnee ist die häufigste Ursache für Feuchtigkeit im Innenraum. Prüfen Sie zuerst die Dachdeckung, Dachrinnen und die Unterspannbahn. Bei Bedarf erneuern Sie die Dachziegel oder das Bitumen und installieren Sie eine moderne Dämmung. Moderne Dämmstoffe wie PUR‑Platten reduzieren den Wärmeverlust um bis zu 60% im Vergleich zu alten Glaswolle‑Dächern.
Ein gut isoliertes Dach senkt nicht nur die Heizkosten, sondern verhindert auch das Eindringen von Kälte im Winter und Hitze im Sommer - ein echter Mehrwert für die Energieeffizienz des Altbaus.
Fassade und Außenwände
Die Fassade außenliegende Wandoberfläche ist die zweite Schutzschicht vor Witterung. Risse, lose Putzstellen oder fehlende Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) führen zu Wärmebrücken und Schimmelbildung. Eine fachgerechte Sanierung beginnt mit der Entfernung des alten Putzes, der Behandlung von Feuchtigkeitsschäden und dem anschließenden Anbringen einer neuen Dämmung.
In Salzburg wird häufig ein Außenputz auf Kalkbasis verwendet, der sowohl atmungsaktiv als auch witterungsbeständig ist. Kombiniert mit einer 12‑cm‑Dämmung erreichen Sie eine U‑Wert‑Verbesserung von 0,30W/(m²·K) auf 0,18W/(m²·K).

Fenster und Türen
Alte Fensterrahmen aus Holz oder Aluminium können massive Energieverluste verursachen. Besonders bei Altbauten, die noch nicht über eine moderne Fensterbank verfügen, ist ein Austausch lohnenswert. Moderne Kunststoff‑ oder Holz‑PVC‑Kombinationen bieten U‑Werte bis zu 0,85W/(m²·K) - das ist fast die Hälfte des alten Zustands.
Beim Einbau neuer Fenster ermöglichen Licht und Luft sollte immer auf eine luftdichte Ausführung und eine gute Absturzsicherung geachtet werden. Auch die Türschwelle muss mit einer Dichtung versehen werden, um Zugluft zu vermeiden.
Haustechnik: Heizung, Elektrik und Sanitär
Die Heizung versorgt das Haus mit Wärme ist das Herzstück für Komfort und Energieeffizienz. Bei Altbauten ist häufig noch eine Ölheizung aus den 70er‑Jahren im Einsatz. Ein Umstieg auf eine Gas‑Brennwerttherme oder - noch besser - auf eine Wärmepumpe reduziert den Jahresverbrauch um 30‑40%.
Parallel dazu muss die Elektrik Stromversorgung und Leitungen auf den aktuellen Stand gebracht werden. Veraltete N‑ und Schutzschalter, fehlende FI‑Schalter und mangelhafte Leitungsquerschnitte stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein Elektriker sollte das gesamte Haus auf neue Leitungen umlegen und moderne Sicherungen installieren.
Die Sanitär Wasserinstallationen für Bad und Küche folgt nach Heizung und Elektrik. Undichtigkeiten in den Leitungen können zu teuren Bauschäden führen. Beim Austausch alter Gussrohre empfiehlt sich ein Kunststoff‑Verbundrohr (PEX), das lange Lebensdauer und hohe Korrosionsbeständigkeit bietet.
Innenausbau: Trockenbau, Fußböden und Oberflächen
Erst nachdem die Haustechnik gesichert ist, können Sie den Innenausbau Trockenbau, Fußböden, Decken beginnen. Hierzu zählen das Anbringen von Trockenbauwänden, das Verlegen neuer Fußböden Beläge für Wohn- und Wohnräume (z.B. Laminat, Parkett oder Vinyl) und das Streichen der Wände.
Ein häufiger Fehler ist, den Innenausbau zu starten, bevor Feuchtigkeitsprobleme und Wärmebrücken behoben wurden. Das führt zu Schimmel an den neuen Böden oder Wänden. Deshalb immer erst Rohbau‑Mängel beseitigen.
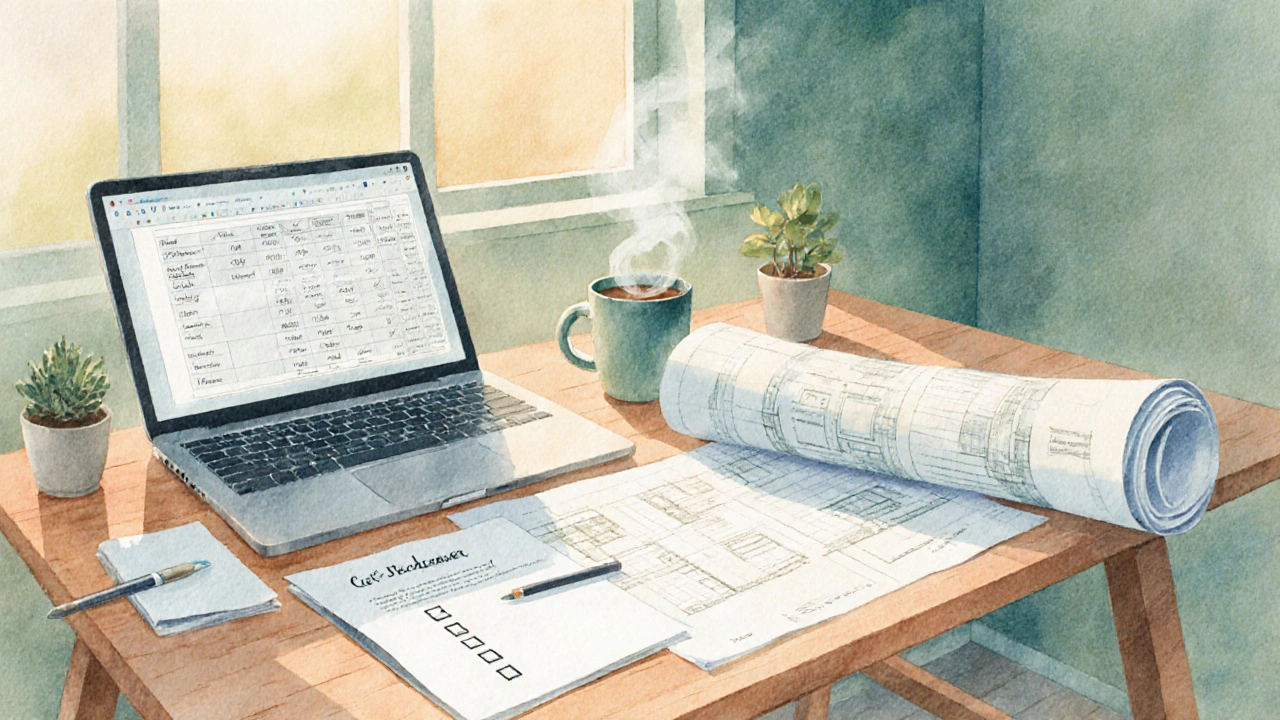
Kostenbudget und Förderungen
Ein realistischer Kostenplan ist das Rückgrat jeder Sanierung. In Österreich gibt es unterschiedliche Förderungen, etwa die "Sanierungsförderung" des Bundesministeriums für Klimaschutz, die bis zu 30% der Sanierungskosten übernimmt, wenn bestimmte energetische Standards erfüllt werden.
Typische Kostenaufteilung (Beispiel für ein 150m²‑Altbauhaus, Zahlen aus 2024/2025):
- Dach + Isolierung: ca. 45000€ (30%)
- Fassade + WDVS: ca. 37500€ (25%)
- Fenster + Türen: ca. 22500€ (15%)
- Heizung & Sanitär: ca. 18000€ (12%)
- Elektrik: ca. 15000€ (10%)
- Innenausbau & Fußböden: ca. 7500€ (5%)
Natürlich variieren die Preise je nach Zustand, Region und Materialwahl. Ein detaillierter Kostenvoranschlag von mindestens drei Fachbetrieben verhindert Überraschungen.
Checkliste zum Start
- Bestandsaufnahme inkl. Feuchtigkeitsmessung.
- Prioritätenliste nach Dringlichkeit erstellen.
- Kostenvoranschläge von Fachbetrieben einholen.
- Fördermöglichkeiten prüfen und Anträge stellen.
- Detail‑Zeitplan mit Puffer für Lieferungen erstellen.
- Alle Aufträge schriftlich fixieren - inkl. Zahlungsplan.
- Baustellenlogbuch führen (Fotos, Notizen, Änderungen).
- Abschluss‑Abnahme mit Handwerkern dokumentieren.
Mit dieser strukturierten Vorgehensweise gehen Sie keine wichtigen Schritte mehr verloren und behalten die Kosten im Griff.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich das Dach immer zuerst renovieren?
Ja, das Dach ist das wichtigste Bauteil zum Schutz vor Wasser. Undichte Stellen führen schnell zu Feuchtigkeit im gesamten Haus.
Wie viel Fördergeld bekomme ich für die Wärmedämmung?
Die Bundesförderung deckt bis zu 30% der förderfähigen Kosten ab, maximal jedoch 15000€. Voraussetzung ist, dass die Sanierung mindestens den Energiestandard KfW‑55 erfüllt.
Kann ich die Elektrik selbst erneuern?
In Österreich dürfen nur zugelassene Elektroinstallateure Arbeiten an der Hauptstromversorgung durchführen. Selber dürfen Sie nur Unterverteilungen oder Leuchten austauschen.
Was kostet ein kompletter Fensteraustausch im Durchschnitt?
Zwischen 500€ und 900€ pro Fenster, inklusive Montage. Der Preis hängt von Rahmenmaterial, Verglasungsart und Größe ab.
Wie erkenne ich, ob das Fundament feucht ist?
Achten Sie auf Schimmel an Wänden, feuchte Stellen im Keller und einen muffigen Geruch. Ein Feuchtigkeitsmessgerät mit Messbereich bis 50% relative Luftfeuchte gibt Aufschluss.

Jörg Gerlach
Oktober 13, 2025 AT 19:03Danke für die klare Übersicht, das hilft bei der Planung.
Dries De Schepper
Oktober 13, 2025 AT 20:26Ach, das ist ja fast schon ein Drama – erst das Dach, dann die Fassade, und ganz unten das Fundament schläft! Ich habe schon unzählige Altbauten gesehen, wo das Dach wie ein undichter Kragen war, und das führte zu lauter Schimmel im ganzen Haus. Also, mein Tipp: Undichtigkeiten zuerst abdichten, sonst wird das ganze Projekt zur Katastrophe. Und wenn Sie noch Fragen zu den Materialien haben, lassen Sie mich wissen, ich habe das passende Fachwort parat.
Angela F
Oktober 13, 2025 AT 21:50Super Beitrag! 😊 Ich habe gerade mein altes Gründerhaus renoviert und kann bestätigen, dass das Dach wirklich das A und O ist. Ein kleiner Tipp: Nach dem Dachwechsel gleich die Dämmung prüfen, das spart später viel Heizkosten. Viel Erfolg bei eurem Projekt! 🌟
Marcelo Mermedo
Oktober 13, 2025 AT 23:13Ein wichtiger Aspekt, den man beim Dach nicht vergessen sollte, ist die Luftzirkulation unter der Dämmung. Ohne richtige Lüftung entstehen wieder Feuchtigkeit – das führt zu Schimmel und strukturellen Schäden. Außerdem sollten Sie beim Austausch der Fenster auf die U‑Werte achten, denn ein niedriger Wert bedeutet langfristig weniger Energieverbrauch. Kombiniert man effiziente Dämmung mit modernen Heizsystemen, kann man den CO₂‑Fußabdruck des Gebäudes um bis zu 40 % reduzieren. 🛠️
Joeri Puttevils
Oktober 14, 2025 AT 00:36Ich stimme völlig zu, dass das Dach primär in die Prioritätenliste gehört. In der Projektmanagement‑Terminologie spricht man hier von einem „Critical Path“, weil Verzögerungen beim Dach sofort den gesamten Zeitplan nach hinten verschieben. Ein weiterer Punkt: Beim WDVS sollte man auf das „Thermal Bridging“ achten, sonst geht die Energieeffizienz verloren. Und nicht vergessen – ein gutes Bau‑Logbuch (BIM‑Integration kann hier helfen) hält alle Stakeholder auf dem Laufenden. 😊
Maury Doherty
Oktober 14, 2025 AT 02:00Manchmal fühlt sich das ganze Renovieren an wie ein epischer Kampf gegen die Zeit und das Wetter. Jeder Balken, jede Ziegeln, jede Schraube trägt ein Stück Geschichte, und doch drängt die Moderne, alles zu erneuern. Ich sitze oft allein im Keller und höre das Tropfen des alten Daches, das Echo vergangener Stürme. Es ist, als ob das Haus selbst spricht und um Rettung bittet. Doch wir müssen stark bleiben, denn am Ende wartet das Licht der neuen Fenster.
Erika Conte
Oktober 14, 2025 AT 03:23Die Entscheidung, ein historisches Gebäude zu renovieren, ist nicht nur eine bauliche, sondern vor allem eine kulturelle und philosophische Herausforderung. Sie verlangt, dass man die Vergangenheit respektiert, während man gleichzeitig die Zukunft gestaltet. In diesem Spannungsfeld müssen Architekten, Handwerker und Eigentümer gemeinsam nach einem Gleichgewicht suchen, das sowohl ästhetische als auch funktionale Kriterien erfüllt. Das Dach, als oberstes Schutzschild des Hauses, symbolisiert das erste Prinzip jeder sicheren Existenz: Schutz vor äußeren Einflüssen. Ohne ein intaktes Dach fallen Regenwasser und Kälte ungehindert in das Innere, wodurch nicht nur Bausubstanz, sondern auch das innere Wohlbefinden der Bewohner gefährdet wird. Die Fassade fungiert dagegen als äußeres Antlitz, das die Identität des Gebäudes nach außen projiziert und gleichzeitig als thermische Barriere dient. Eine gut geplante Fassadensanierung kann deshalb nicht nur Energieeinsparungen bringen, sondern auch das kulturelle Erbe sichtbar bewahren. Elektrische Systeme hingegen repräsentieren das unsichtbare Netzwerk, das das moderne Leben erst ermöglicht – hier gilt absolute Sorgfalt, denn ein Defekt kann schnell zur Gefahrenquelle werden. Die Priorisierung dieser Bauteile lässt sich am besten mit einer Risiko‑Nutzen‑Analyse quantifizieren, wobei die möglichen Kosten eines Ausfalls gegenüber den Investitionen abgewogen werden. Dabei sollte man nicht nur monetäre Werte betrachten, sondern auch den immateriellen Wert, den ein intaktes historisches Bauwerk für die Gemeinschaft darstellt. Der Einsatz von Fördermitteln kann diesen Prozess zusätzlich erleichtern, wenn die energetischen Standards klar definiert und nachweislich eingehalten werden. Auf der technischen Seite empfiehlt sich die Verwendung von modernen Dämmstoffen, die zwar effizient, aber gleichzeitig diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsstau zu verhindern. Gleichzeitig sollte man darauf achten, dass die Auswahl der Materialien mit den ursprünglichen Baustoffen harmoniert, um ein authentisches Erscheinungsbild zu bewahren. Der Innenausbau darf erst nach Abschluss aller Rohbaumaßnahmen beginnen, da sonst das Risiko besteht, dass neu installierte Oberflächen durch nachträgliche Sanierungen beschädigt werden. Letztlich ist das Ziel einer Altbausanierung nicht nur, ein Gebäude wieder bewohnbar zu machen, sondern ein lebendiges Zeugnis vergangener Zeiten in die Gegenwart zu tragen. Wer diese Philosophie verinnerlicht, wird bei der Planung und Umsetzung jedes Schrittes eine tiefere Zufriedenheit empfinden.
Franz Meier
Oktober 14, 2025 AT 04:46Ich seh das so: Fördergelaen kann die Kosten senken, aber nu muss man erst ein Antrag ausfülen und dann warten. Wenn man das nich macht, bleiben die Mittel ungenutzt. Das ist leider ein gängiger Feher im Prozess.
Walther van Berkel
Oktober 14, 2025 AT 06:10Ein strukturiertes Vorgehen, wie es in der vorherigen Diskussion beschrieben wurde, schafft Klarheit und reduziert das Risiko unerwarteter Kosten. Es ist empfehlenswert, bereits in der frühen Planungsphase ein Risikoregister zu führen, in dem potenzielle Probleme und deren Maßnahmen festgehalten werden. So können Sie proaktiv reagieren, anstatt reaktiv zu handeln. Außerdem sollte die Kommunikation zwischen allen Beteiligten durch regelmäßige Baubesprechungen gesichert werden, damit Missverständnisse frühzeitig geklärt werden können. Diese Methode fördert nicht nur die Effizienz, sondern stärkt auch das Vertrauen im Projektteam.